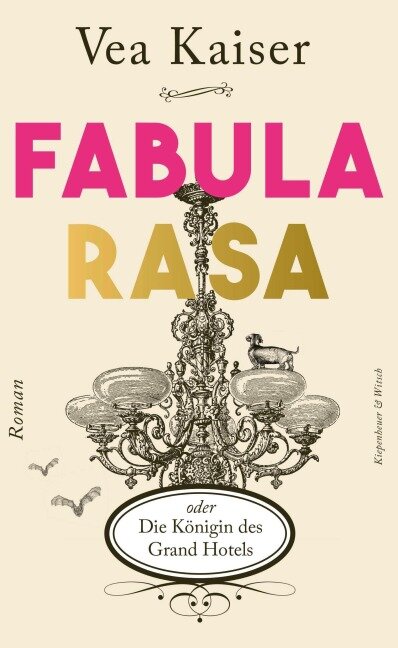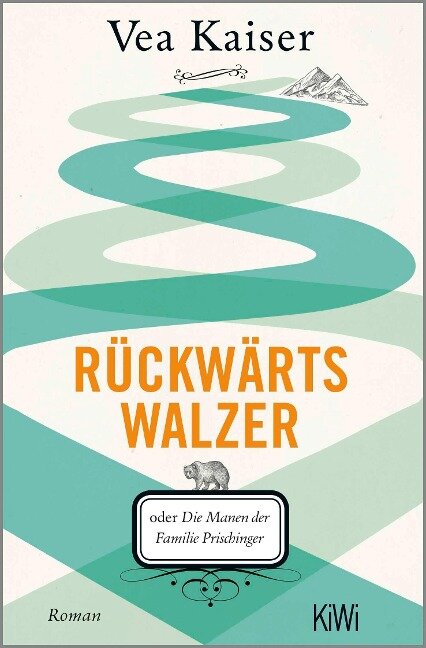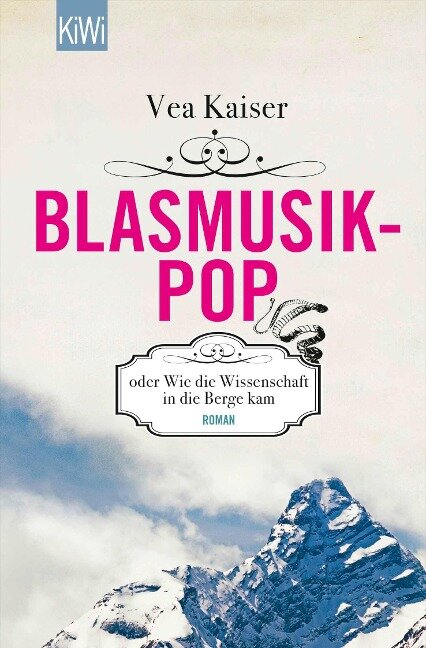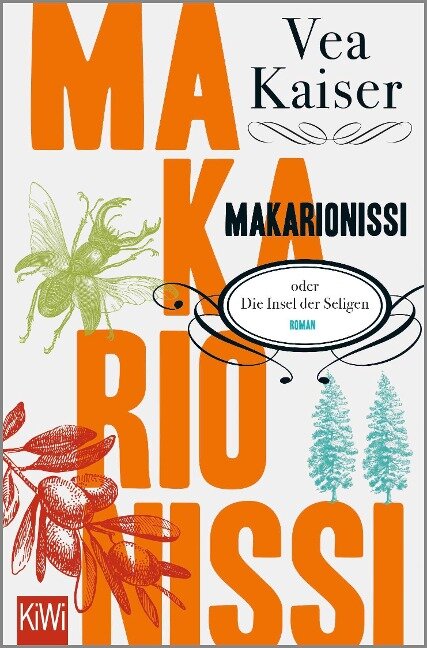„Zum Stillhalten hat man im Grab noch genug Zeit.“
Vea Kaiser nimmt uns in ihrem neuen Roman Fabula Rasa mit ins Wien der späten Achtzigerjahre – und erzählt von Angelika Moser, einer Frau, die mit Witz, Mut und unkonventionellen Mitteln ihr Leben in die eigenen Hände nimmt. Für schönerlesen sprach sie über Gerechtigkeit, Improvisationstalent und die Kraft der Veränderung.
Angelika Moser ist Hausbesorger-Tochter, alleinerziehend, Buchhalterin – und Ihre Heldin im neuen Roman. Was war zuerst da: die Figur oder die Geschichte?
Die Geschichte der Figur! Meine Ur-Idee war es, über eine Frau zu schreiben, die zur Betrügerin wird, obwohl sie eigentlich ein sehr anständiger, keineswegs krimineller Mensch ist. Was muss in unserem Leben passieren, damit wir etwas Verbotenes tun? Diese Frage interessiert mich brennend. Ich denke, dass wir Menschen unterschätzen, wie sehr die äußeren Umstände darüber entscheiden, ob wir mit Leichtigkeit korrekt und anständig handeln können oder gezwungen sind, Grenzen zu überschreiten.
Die Stadt war grau, garstig und lag am Rande der Welt ...
Das Buch spielt zu Beginn im Wien der späten Achtziger. Was hat Sie an dieser Zeit gereizt?
Seit ich selbst mit fünfzehn, sechzehn begann, in Wien abends auszugehen, hörte ich von Älteren: Egal, was du erlebst, es wird nie so gut sein wie im Wien der Achtziger. Alle schwärmten von der Diskothek U4, alle behaupteten, Falco persönlich gekannt zu haben. Unisono hört man in dieser Stadt: So gut wie es Mitte der Achtziger war, kann es nie wieder werden. Das fand ich immer schon unfair den jungen Leuten gegenüber, und wahrscheinlich hat es mich irgendwie gewurmt, diese Zeit verpasst zu haben, sodass ich eine Figur erfinden musste, um mir meinen Anteil an dieser faszinierenden Epoche zu erschreiben. Die Stadt war grau, garstig und lag am Rande der Welt, ein paar Kilometer vom Eisernen Vorhang entfernt, der Mief einer schrecklichen Vergangenheit wehte durch die kaputten Straßen, aber damit gab sich die Jugend nicht mehr zufrieden: Man suchte das Extrem, alles hat gebrodelt, vibriert, der Aufbruch in ein neues Zeitalter war zu spüren. Gleichzeitig hat diese Neuerungswut auch nicht allzu lang gedauert, und meine Heldin Angelika Moser ist ein Kind des New Wave, verpasst aber dessen Ende und trauert Ende der Achtziger den wilden frühen Achtzigern hinterher. Sie fragt sich: Und was jetzt? Diese Phasen im Leben finde ich grundsätzlich am spannendsten: wenn man die Weichen neu stellen muss.
Angelika hat wenig Geld, wenig Unterstützung, aber viel Energie und Witz. Sie bringt das Hotel mit schrägen Buchhaltungstricks zum Laufen. Wie sehr ist das auch eine Geschichte über weibliches Improvisationstalent?
Es ist vor allem eine Geschichte über eine Frau, die sich nicht von widrigen äußeren Umständen unterkriegen lässt. Was ich nicht mehr lesen kann, sind Romane über weibliche Opfer. Geschichten, meist von Männern geschrieben, in denen die Frauen die armen unschuldigen Mäuse sind, die an der Härte und Garstigkeit der Welt zugrunde gehen. Das finde ich uninteressant. Ich wollte die Geschichte einer Frau erzählen, die sich weigert, im Klagen und Leiden aufzugehen, die das allen Frauen eigene Improvisationstalent nicht nutzt, um irgendwie mit den äußeren Umständen zurechtzukommen, sondern die sich die Welt zurechtbiegt, um gut zu leben. Sicherlich tut sie auch „Verbotenes“ oder handelt nicht dem Gesetz entsprechend. Aber ob das moralisch auch falsch ist, das müssen dann die Leserinnen und Leser entscheiden – und oh mein Gott – ich bin so neugierig, wie die das empfinden! Der Roman stellt nämlich schon die Frage danach, was gerecht ist. Z. B.: Wie gerecht ist es, dass sich ein Firmenchef seine Golf-Touren von der Firma bezahlen lässt, weil er dabei ja auch wichtige Gespräche mit Geschäftspartnern führt, aber die einfachen Angestellten nicht einmal einen Zuschuss zu ihren Kinderbetreuungskosten erhalten? Ich glaube, die Geschichte einer Frau, die nicht das tut, was das Gesetz von ihr erwartet, stellt die Frage danach, was eigentlich gerecht ist. Und ob unsere Gesellschaft Frauen, insbesondere Mütter, überhaupt gerecht behandelt: Denn man erwartet von ihnen, dass sie alles tun für ihre Kinder, ihre kranken Angehörigen, ihre Familien – aber was wird eigentlich für sie getan?
Die Angst vor der Bürokratie hat einen Buchhaltungs-Nerd aus mir gemacht
Sie selbst haben Altgriechisch studiert – Angelika liebt Zahlen. Gibt es da eine Verbindung?
Altgriechisch ist tatsächlich eine eher dynamische, nicht allzu starre Sprache. Latein ist viel geregelter. Da gibt es eher keine Verbindung. Die Verbindung zwischen Angelikas Ordnungsliebe und mir ist meine große epische Angst vor dem Finanzamt. Seit ich als Autorin selbstständig tätig bin, habe ich Angst vor Nachzahlungen, unerwarteten Kosten, Gebühren etc., die mich in den plötzlichen Ruin treiben und meinem schönen Leben in seiner Unabhängigkeit ein Ende setzen. Die Angst vor der Bürokratie hat einen Buchhaltungs-Nerd aus mir gemacht. Ich liebe es, meine Dokumente, Einnahmen, Ausgaben etc. in Ordnung zu bringen und zu wissen: Es kann mir nix passieren, ich hab‘ alles im Griff. Ich habe alle wichtigen Dokumente abgeheftet und kenne die Kosten, die auf mich zukommen. Ohne buchhalterische Ordnung würde ich wahnsinnig werden und jede Nacht um 4 Uhr mit pochendem Herz aufschrecken.
Wir erwarten gesellschaftlich von Frauen, dass sie brav und ehrlich und anständig sind

Wie weit darf man gehen, wenn man Gutes will? Angelika biegt ihre Zahlen, damit andere ihren Job behalten. Ist das Heldentum?
Wie heldenhaft Angelika Moser handelt, müssen die Leserinnen und Leser selbst beantworten. Da hab‘ ich auch nur eine private Meinung, keine Antwort. Aber ein interessanter Fakt, der mir während der Arbeit an der Geschichte aufgefallen ist, ist, dass wir die „Grenzüberschreitungen“ von Männern immer anders bewerten als die von Frauen. Wirtschafts- und Steuerbetrug ist ja fast immer männlich und man hat sich nicht nur daran gewöhnt – das gilt als „Kavaliersdelikt“ (man überlege: Kavalier!). Uli Hoeneß saß wegen Steuerhinterziehung im Gefängnis und ist jetzt Ehrenpräsident (Ehren!) des FC Bayern München. Als ob nie etwas gewesen wäre, so, als ob er nicht Steuern, die – weiter gedacht – für den Ausbau der Kindertagesstätten hätten verwendet werden sollen, mutwillig einbehalten hat aus Gier. Manchmal hab‘ ich das Gefühl, bei mächtigen Männern geht man fast davon aus, dass sie ein bissi kriminell auch sind. Währenddessen läuft in Österreich gerade eine große Fahndung nach einer „Schamanin“, einer Frau, die von wohlhabenden Leuten viel Geld genommen hat, um ihre Aura zu reinigen. Aber ich verstehe nicht: Was ist daran Betrug? Wenn jemand wirklich daran glaubt, dass es eine verfluchte, zu reinigende Aura gibt, und dafür Geld zahlt, dann ist das doch eine freiwillige Handlung. Diese Frau wird medial dargestellt als die größte Verbrecherin des Landes, und ich versteh nicht, warum. Wir erwarten gesellschaftlich von Frauen, dass sie brav und ehrlich und anständig sind. Männer sind halt Männer, die dürfen auch ein bissi schlimm sein. Aber wenn eine Frau etwas Unerlaubtes tut, wird das tendenziell als viel ärger wahrgenommen.
In Ihren Romanen geht es oft um Aufbrüche, um Menschen, die in Bewegung kommen. Auch Angelika verändert sich. Wie wichtig ist Ihnen, dass Figuren nicht bleiben, wie sie sind?
Vielleicht kann man interessante Romane über statische, immergleich bleibende Figuren schreiben – ich jedoch könnte das nicht, denn ich halte Stillstand kaum aus. Physisch nicht, ich muss mich jeden Tag bewegen, jeden Tag den Geist rotieren lassen. Zum großen Leid meines Mannes verändere ich auch regelmäßig die Anordnungen der Möbel, Bilder – bei mir muss alles in Bewegung bleiben. Und dementsprechend ist wahrscheinlich auch in den Büchern immer alles in Bewegung. Zum Stillhalten hat man im Grab noch genug Zeit.
Der Titel spielt auf „tabula rasa“ an – also auf einen radikalen Neuanfang. Wann hatten Sie zuletzt das Gefühl, bei null anfangen zu müssen?
Schriftstellerin zu sein, bedeutet, regelmäßig bei null anzufangen. Bevor ich mein erstes Buch geschrieben hatte, stellte ich mir das Vollenden eines Romans als etwas sehr Freudiges, Erhebendes, Großartiges vor. Tatsächlich ist es aber so, dass ich vor allem ein Gefühl bei der letzten finalen Abgabe empfinde: Traurigkeit. Jahrelange Arbeit ist mit einem Fingerschnippen vorbei. Figuren, die mir ans Herz gewachsen sind, sind weg. Alles, was an Recherchen und Überlegungen im Hintergrund passierte, ist nun egal. Man muss wieder von vorne anfangen, bei null. Ich mache nach jeder Abgabe sogar wortwörtlich tabula rasa! All meine Romane lebten in Form von Notizen, Bildern, Skizzen und Kritzeleien auch haptisch auf einer Wand in meinem Büro. Nach der Abgabe werden all diese Zettel abgenommen, in eine Kiste verstaut und auf den Dachboden verfrachtet. Tabula rasa, damit ich fabula rasa machen kann.
... das Gefühl, Chefin des eigenen Lebens zu sein – ist schlagartig dahin
Zwischen Grandhotel und Gemeindebau, Nachtleben und Mutterpflichten: Angelikas Alltag ist voller Kontraste. Kennen Sie das aus Ihrem eigenen Leben?
Wer nicht? Vor allem: Welche berufstätige Mutter kennt das nicht? Im einen Moment rockt man die Konferenz, und im nächsten stolpert man beim Reinkommen über den Puppenwagen oder tritt auf einen Legostein, die Kinder schreien einen an, der Hund kotzt, und das erhabene Glücksgefühl, das man soeben noch hatte – das Gefühl, Chefin des eigenen Lebens zu sein – ist schlagartig dahin. Ich erlebe das immer wieder nach Lesungen. Da rockt man die Bühne, und zuhause türmen sich die Geschirrberge, vorwurfsvoll flüstern die benutzten Fläschchen: Ist uns egal, ob du heute fünf Minuten langen Applaus bekommen hast – Gummihandschuhe anziehen und Haushalt erledigen.
Was ist Ihnen beim Schreiben besonders leichtgefallen – und was hat Ihnen das Leben schwer gemacht?
Bei diesem Roman hat es tatsächlich sehr lange gedauert, bis ich die Erzählperspektive gefunden hatte. Zuerst wollte ich die Heldin selbst sprechen lassen, aber das hat nicht funktioniert. Ich habe viele Male zu schreiben begonnen, alles wieder verworfen, es anders versucht, wieder verworfen, bis ich auf die Idee kam, den Roman selbst zu erzählen: Eine Schriftstellerin namens Vea Kaiser besucht im Gefängnis eine verurteilte Betrügerin namens Angelika Moser, von der sie in der Zeitung gelesen hat, und lässt sich ihre Geschichte erzählen. Vea Kaiser ist nämlich fasziniert von der Rechtfertigung, die Angelika Moser dem Gericht gegeben hat: All die Millionen habe sie aus reiner Mutterliebe gestohlen. Die Schriftstellerin ist zu diesem Zeitpunkt schwanger mit ihrem ersten Kind und versteht Angelika Mosers Motivation: Welche Mutter ist nicht bereit, alles für ihr Kind zu tun, was notwendig ist, damit es ihm gut geht? Mutterliebe ist eine übermenschliche Superkraft. Es gibt den dokumentierten Fall einer Mutter, die nach einem Unfall solch einen Beschützerinstinkt für ihr unter dem Auto eingeklemmtes Kind entwickelte, dass sie allein das Auto hochgehoben hat. Eine ganz normale Frau – von der Mutterliebe zur Superheldin erhoben. Als diese Erzählperspektive endlich feststand – was aber sicher ein Jahr gedauert hat –, schrieb sich der Roman flüssig, locker und leicht. Wenn ich halt dazu kam. Denn das war das Allerschwierigste: neben zuerst einem, dann zwei Kindern unter drei Jahren konzentriert zu arbeiten. Drei Jahre lang hab‘ ich alles, was mir sonst Spaß macht, aufgegeben (notwendige Ausnahme: Lesen). Ich habe nur mit den Kindern im Kinderwagen Sport gemacht, kein einziges Mal abends Freunde getroffen und keine einzige Serie geschaut: Jede Minute Freizeit opferte ich für diesen Roman. Und das war im Nachhinein doch sehr hart. Aber ich würd’s wieder tun.
Einige der wunderbarsten Leseerlebnisse meines Lebens verdanke ich Buchhändlern ...
Und zum Schluss zwei Fragen zum Buchhandel: Worauf achten Sie selbst, wenn Sie eine Buchhandlung betreten?
Persönlich versuche ich so gut wie möglich, nur bei inhabergeführten Buchhandlungen einzukaufen – sowieso stationär. Wie man online Bücher bestellen kann, ist mir ein Rätsel. Das Erlebnis, sie vorher zur Hand zu nehmen, ein paar Seiten reinzulesen, mich mit der Buchhändlerin über ihre Eindrücke oder die Rückmeldungen von Kunden zu unterhalten – das würde ich nie missen wollen. Einige der wunderbarsten Leseerlebnisse meines Lebens verdanke ich Buchhändlern, die mir Bücher in die Hand drückten, zu denen ich sonst nicht gegriffen hätte. Was ich nicht so super finde, ist, wenn Buchhändlerinnen jungen Kunden gegenüber die Nase über „populäre“ Literatur rümpfen. Man darf natürlich bei einem Glas Scotch mit befreundeten Buchhändlern oder Autorinnen (machen Sie das! Autoren sind alle Lästerschweine) über diverse Trends schimpfen, aber ich finde es wichtig, über jede junge Leserin froh zu sein – denn die kommen wieder, und irgendwann wollen sie vielleicht auch „was wirklich Gutes“ lesen. Wenn wir sie allerdings mit Verweis auf die hohe und elitäre Lektüre vergraulen, bekehren wir sie nie, sondern verlieren sie für immer. Wir brauchen Freundinnen, die uns was kochen, das wir noch nie gekostet haben, oder einen Wein aus einer Region einschenken, von der wir noch nie hörten. Wir brauchen Fitnesstrainer, die uns helfen, unseren Körper so zu behandeln, dass er vital und gesund bleibt. Und wir brauchen Buchhändlerinnen, die uns den Reichtum der Literatur eröffnen, Neuerscheinungen empfehlen, die wir übersehen würden, um unseren Horizont zu erweitern. Was war die schönste Begegnung, die Sie je in einer Buchhandlung hatten? Tatsächlich waren es so viele, dass ich mich unmöglich auf eine festlegen kann. Manchmal erlebt man Skurriles, wie wenn dich eine Frau anspricht und sagt: „Entschuldigung, ich kenn Sie! Sie sind doch die Autorin!“, und dann antwortet man gerührt: „Ja, die bin ich.“ Und dann kommen unerwartete Reaktionen wie: „Also ich hab‘ Sie mir kleiner vorgestellt.“ Oder: „Ich mochte Ihren Roman Quasikristalle sehr gern, Frau Menasse.“ Aber meist sind Buchhandlungen für eine Schriftstellerin der Ort der Erlösung. Das Schreiben ist die einsamste Tätigkeit der Welt: Jahrelang fantasiert man etwas zusammen, ohne zu wissen, ob es je jemand lesen wird – und wenn ja, ob es überhaupt jemanden interessiert, berührt, fesselt. In Buchhandlungen wird aus der Einsamkeit die Gemeinschaft der Lesenden. Man teilt Eindrücke, man erzählt sich Anekdoten rund ums Leseerlebnis. Man lernt endlich die Menschen kennen, für die man jahrelang die Stille ertrug. Und dann schaut man in die Regale, und der Reichtum der Weltliteratur lächelt einen an und sagt: Bilde dir bloß nix ein! Uns gibt es auch. Und dann verspürt man diese tiefe Dankbarkeit, für andere Menschen schreiben zu dürfen und gelesen zu werden. Und die Motivation, so schnell als möglich weiterzuschreiben. Und einen noch besseren Roman zu produzieren, wieder einsam zu sein, um dann wieder in der Buchhandlung zu merken, warum man das tut.
Vielen Dank für das Gespräch!