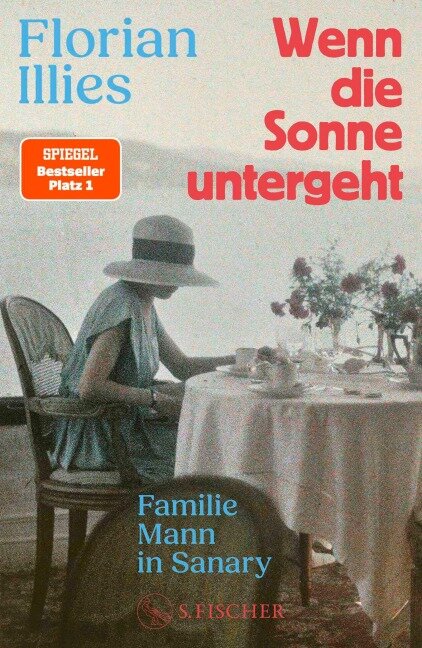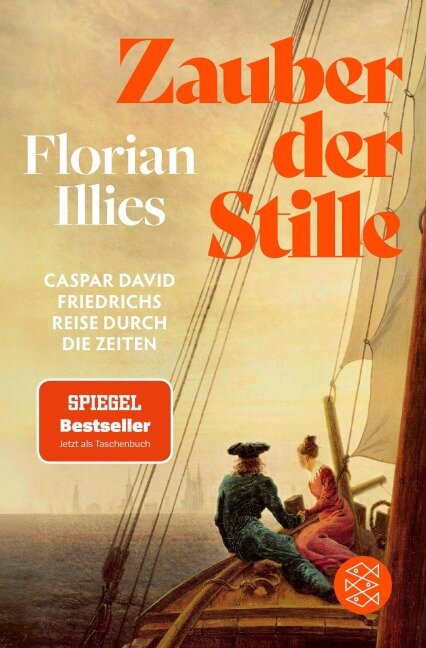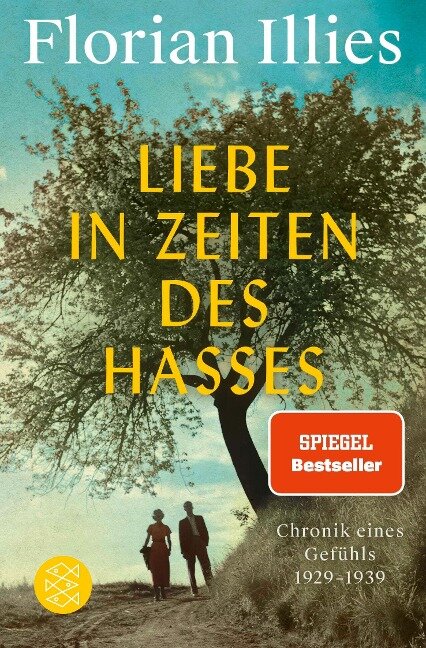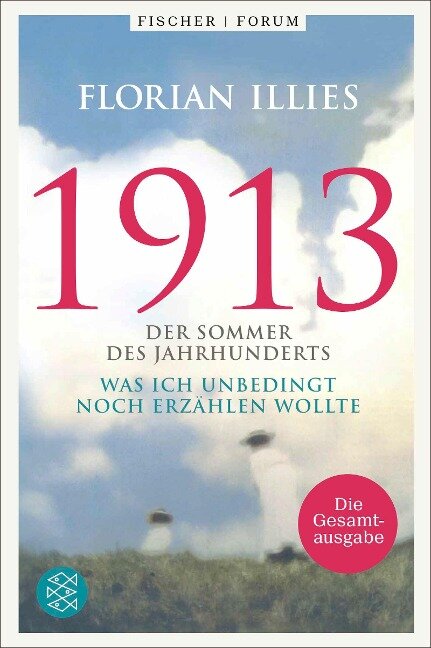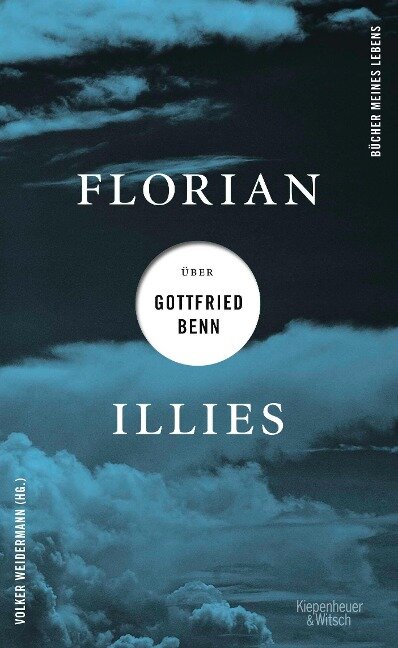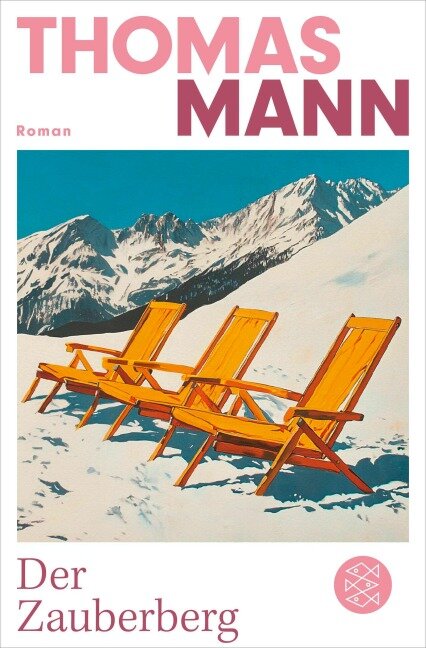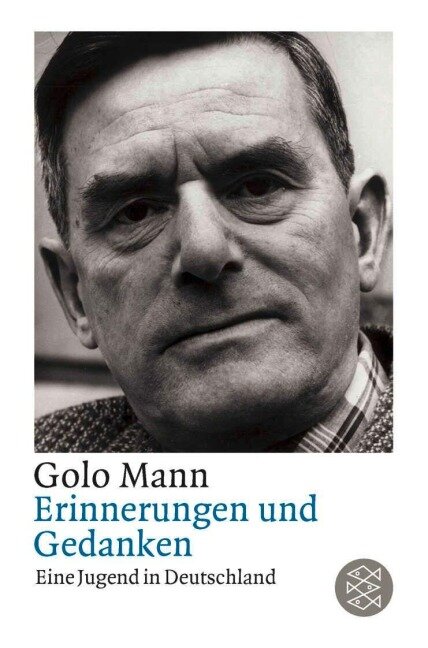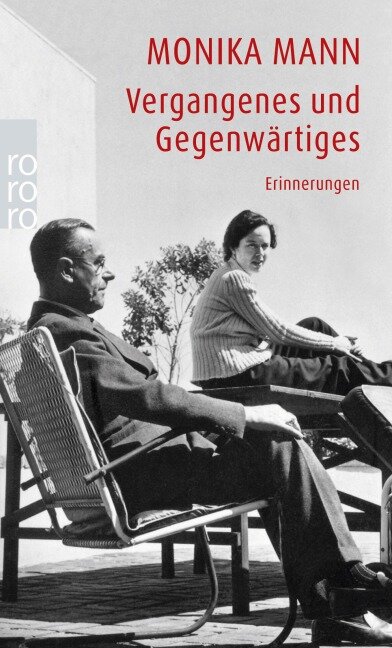„Von einem Tag auf den anderen zerbrachen alle Träume.“
Florian Illies hat sich für sein neues Buch tief in das Jahr 1933 und die Familie Mann versenkt. Im Gespräch erzählt er, welche Quellen ihn bewegten, welche Figuren ihn faszinieren – und warum er den unabhängigen Buchhandel liebt.

Lieber Herr Illies, wann kam der erste Funke – der Moment, in dem Sie wussten: Über diese Zeit, diesen Sommer der Manns, muss ich schreiben?
Ich trage ja viele Funken für viele Bücher in mir. Und manchmal kommt, ganz überraschend, ein leichter Wind auf und dann fange ich Feuer. In diesem Fall liegt dies lange zurück, während der Recherchen von “Liebe in Zeiten des Hasses” bin ich immer wieder auf Sanary gestoßen und dabei natürlich auch auf die Manns und irgendwann merkte ich, dass genau diese Familie an genau diesem Ort in genau diesem Jahr 1933 ein Thema ist, dass ich unbedingt erzählen möchte.
Welche Quelle hat Sie am meisten überrascht oder berührt – ein Brief, ein Tagebuch, ein Augenzeugenbericht?
Es gibt drei Quellen, die mich am meisten berührten - und die Menschen dahinter. Da sind zum einen die gedruckten Erinnerungen von Golo Mann und dann seine gesperrten Tagebücher dazu in Bern. Zum anderen die verträumten kleinen Bücher von seiner Schwester Monika, die einen ganz eigenen Blick auf diese Familie und diese Zeit ermöglichen. Und dann schließlich die Briefe und Tagebücher der Großmutter, Hedwig Pringsheim, die erst vor wenigen Jahren veröffentlicht wurden und die den ganzen täglichen Wahnsinn dieser Jahre aus einer völlig unerwarteten, erfrischenden Perspektive erzählen.
Gab es bei der Recherche einen Moment, der Ihnen besonders nahe ging?
Ja. Das war der Moment, als ich realisierte, dass Heinrich Mann mit seiner Nelly gerade sechs Wochen in der neuen gemeinsamen Wohnung in der Berliner Fasanenstraße lebte, bevor er nur mit einem Regenschirm Deutschland verlassen musste. Und die Feuchtwangers lebten nur einen Herbst in ihrem neugebauten prachtvollen Haus im Grunewald – und dann brach die Barbarei los, sie flüchteten. Die Wohnung von Heinrich wurde genauso verwüstet wie das Haus der Feuchtwangers. Wenn man sich vor Augen hält, wie schnell es gehen kann, wie kurz der Traum von einer neuen Normalität war und wie brutal der Klimasturz nach dem 30. Januar 1933, wenn ich versuche, mich in die Menschen hineinzuversetzen, die realisieren müssen, dass ihr bisheriges Leben, ihre Sehnsüchte, ihre Träume sich von einer Sekunde auf die andere in Luft auflösen und durch blanke Angst ersetzt werden – dann berührt mich das sehr. Und ich versuche beim Schreiben diese Berührung nicht zu verbergen.
Diese Familie Mann ist wirklich auf eine unvergleichliche Weise faszinierend.
Welche Figur hat Sie beim Schreiben am meisten fasziniert?
Diese Familie Mann ist wirklich auf eine unvergleichliche Weise faszinierend. Die Eltern! Die sechs Kinder! Die Großeltern! Dann Heinrich und Nelly. Ich fiel beim Recherchieren und Schreiben von einer Faszination und einem Erschrecken ins nächste. Klaus imponiert mir sehr, seine Tagebücher aus dem Jahr 1933 halte ich für eines der hellsichtigsten Dokumente jener Jahre überhaupt. Golo ist mir sehr ans Herz gewachsen, wie er als letzter Statthalter der Manns in Deutschland alles regelt, Geld schmuggelt, seine Schwester über die Grenze bringt – und dennoch kaum Anerkennung vom Vater dafür bekommt. Und dann die herrlich verpeilte Moni, wie saumselig sie durch dieses fürchterliche 1933 wandelt – und als dann alle im September aus Sanary abreisen, bleibt sie einfach da, badet im Meer und spielt Klavier. Von all diesen besonderen Menschen erzähle ich in diesem Buch.
War Sanary für die Familie Mann Zuflucht oder Zerrissenheit?
Erst war es ein Ort der Zuflucht. Alle sind dankbar, vor allem Thomas Mann, wieder ein Haus, eine Villa zu bewohnen nach den bedrückenden Monaten in den Hotels. Und dann das wundervolle Klima, die Palmen, die Leichtigkeit des Südens. Das hilft. Aber je mehr die Schreckensnachrichten aus Deutschland nach Südfrankreich dringen, je mehr sich Klaus und Erika gegen ihren Vater und seine geplante Veröffentlichung von »Joseph und seine Brüder« in Deutschland stellen, um so mehr wird Sanary auch zum Ort einer großen Zerreißprobe.
Hat sich Ihr Blick auf die Familie Mann geändert, nachdem Sie so tief in das Familienleben eingetaucht sind?
Ja, sehr. Ich habe ja bewusst versucht, dieses Jahr 1933 nicht als eines des Helden Thomas Mann zu erzählen, sondern als Familienaufstellung. Ich versuche, alle Kinder und auch Katia sichtbar und erfahrbar zu machen – auch diesen unfassbaren Druck, der in dieser Familie herrschte. Die Angst davor, den Vater zu langweiligen oder in seiner Ruhe zu stören. Diese schrecklich nette Familie ist mir nach den zwei Jahren mit ihr sehr viel näher gekommen – und sehr viel fremder geworden.
Welche Rolle spielt die Literatur der Manns in Ihrem eigenen Leben?
Der »Zauberberg« mit seiner einzigartig erzählten Vorkriegsatmosphäre war natürlich zentral für mein Buch über das Jahr 1913. Mit den Romanen des traurigen Klaus konnte ich bisher weniger anfangen, aber nun bin ich der Klarheit und Weitsicht seiner Tagebücher ganz erlegen. Und Golos Erinnerungsbücher haben mich früh sehr beeindruckt – bis ich jetzt beim Schreiben realisierte, wie sehr sie einem Leben im Schatten des Vaters abgetrotzt sind.
Welches Buch der Manns liegt Ihnen persönlich am meisten am Herzen?
Der »Zauberberg« von Thomas. »Erinnerungen und Gedanken. Eine Jugend in Deutschland« von Golo. Die Tagebücher von Klaus. Und Monikas viel zu wenig bekannte Erinnerungen »Vergangenes und Gegenwärtiges«.
(Diese Titel können Sie am Ende des Interviews bestellen)
Was wünschen Sie sich, dass Leser:innen aus Ihrem Buch mitnehmen?
Ich hoffe darauf, dass sie einen neuen Blick gewinnen – auf das deutsche Schicksalsjahr 1933 und auf die deutsche Schicksalsfamilie Mann.
Ich liebe die Atmosphäre der kleinen Buchhandlungen
Und zum Abschluss, da wir das Büchermagazin des unabhängigen Buchhandels sind: Was bedeuten Ihnen unabhängige Buchhandlungen persönlich – gehen Sie selbst gerne dorthin? Was können unabhängige Buchhandlungen, was große Ketten oder der Online-Handel nicht leisten?
Ja, natürlich, ich bin bestimmt jede Woche einmal in der Buchhandlung bei mir um die Ecke. Früher war das die Georg-Büchner-Buchhandlung in Berlin, jetzt Ferlemann & Schatzer und die Buchhandlung am Bayrischen Platz. Und viele andere in Berlin, Ocelot etwa, wo ich immer vorbeigehe, wenn ich in der Nähe bin. So viele meiner größten Leseerlebnisse verdanke ich diesem ziellosen Suchen, diesem Hineinlesen, diesem Überraschtwerden vor Ort. Ich liebe die Atmosphäre der kleinen Buchhandlungen, die Leidenschaft der Buchhändlerinnen und Buchhändler, mit der sie mir von ihrer letzten Lektüre erzählen – und mich sehr oft damit anstecken. Und weil ich weiß, wie sehr der Erfolg meiner Bücher darauf beruht, dass es gerade diese kleinen Buchhandlungen sind, die ihren Kunden von meinen Werken erzählen, versuche ich auf meinen Lesereisen auch immer vor Ort so viele wie möglich zu besuchen und dort Bücher zu signieren. So auch in diesem Herbst.
Vielen Dank für das Gespräch!